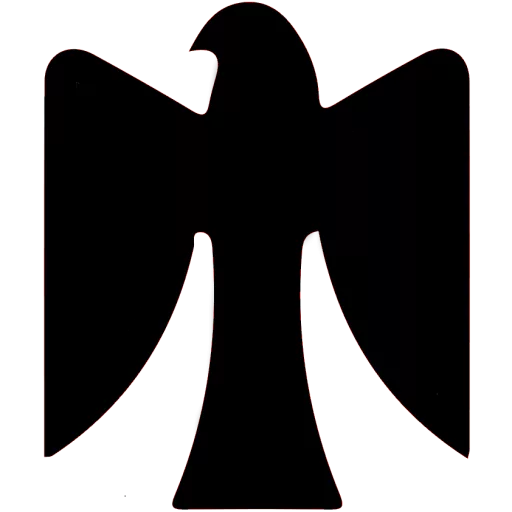Beim Frauen*kampftag waren wir mit einem Redebeitrag vertreten, um auf die geschlechtsspezifischen Folgen von Krieg und Militarisierung der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Lest hier unseren Beitrag!
Seit über einem Jahr tobt in der Ukraine ein blutiger Krieg, ausgelöst durch den Überfall Russlands auf das gesamte Territorium seines Nachbarlandes. Das Thema Krieg ist seitdem in der europäischen Öffentlichkeit stets präsent und täglich wird deutlich, dass kriegerische Auseinandersetzungen auch in Hinblick auf ihre geschlechtliche Komponente eine gesellschaftliche Regression darstellen. Während Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit in den vergangenen Jahrzehnten offener diskutiert wurden und ein Aufweichen von Geschlechtergrenzen eine Komponente postmoderner Gesellschaften ist, ist in einem Angriffskrieg plötzlich alles anders:
Das betrifft einerseits natürlich die unmittelbaren Auswirkungen des Kriegsgeschehens auf die Menschen vor Ort. So hat die Verteidigung der nationalen Souveränität der Ukraine gegen die imperialistischen Bestrebungen Russlands für die konkreten Männer und Frauen im Land durchaus unterschiedliche Konsequenzen: Frauen sind plötzlich mit ihren Kindern auf sich allein gestellt, müssen die Flucht ergreifen oder sehen sich vor Ort der durch den Krieg gestiegenen Gefahr sexualisierter oder anderer Gewalt ausgesetzt. In Abwesenheit von Partnern, Vätern und Brüdern und unter ständiger Verunsicherung des eigenen (Über)lebens übernehmen vor allem Frauen Verantwortung für Kinder, Alte und Schwache, helfen und (ver)sorgen – vor Ort oder auf der Flucht.
Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter dürfen das Land hingegen nicht verlassen. Die ihnen zugedachte Aufgabe ist die der Landesverteidigung und regelmäßig werden sie in diesem Zusammenhang von Politiker*innen im In- und Ausland mit anerkennenden Worten für Tapferkeit und Widerstandskraft bedacht. Es scheint, als mache der Krieg Männer zu Helden – von allen anerkannt, stark, mutig, furchtlos und entschlossen. Die Regierenden der europäischen Staaten und der ukrainische Präsident selbst adressieren die Soldaten natürlich nicht zufällig auf diese Weise: Um sicherzustellen, dass die Landesverteidigung (und damit im öffentlichen Diskurs eng verbunden die Verteidigung westlicher Werte) weiterhin gewährleistet bleibt und die russische Armee keine weiteren Landesteile erobert, ist eine ermutigende und anerkennende Ansprache der Soldaten nur folgelogisch und für das staatliche Interesse der nationalen Verteidigung zweckdienlich. Doch bedeutet sie notwendig auch ein Absehen vom Leid des konkreten Individuums, das an der Front „seinen Mann stehen“ muss, d.h. von den Folgen des Krieges für jeden einzelnen Mann. Krieg bedeutet für die Soldaten in erster Linie die Zurichtung des eigenen Selbst, die Missachtung individueller Grenzen, die Ausbildung von Härte gegen sich und Andere – nicht zufällig Attribute, die mit klassisch männlicher Subjektwerdung assoziiert sind. Krieg ist (auch wenn einige Frauen in ihm kämpfen) durch und durch männlich, auf dem Schlachtfeld ist kein Platz für Angst, Unsicherheit oder Zweifel – obwohl einem diese Eigenschaften mit Blick auf das zutiefst menschenverachtenden Morden nur allzu verständlich erschienen müssten. So produziert die Schlacht in Wirklichkeit keine Helden, sondern Männer, deren weiteres Leben und deren Rückkehr in zivile gesellschaftliche Zusammenhänge von der soldatischen und im negativsten Sinne „männlichen“ Zurichtung geprägt sein wird, die ihnen angetan wurde und die sich sich selbst antun müssen, um jetzt in der Kriegssituation zu bestehen.
Welche Auswirkungen die aktuell vermeintlich zweckdienliche Ausbildung von soldatischer Männlichkeit für die Gesellschaft nach einem Ende des Krieges haben wird, was ein Zusammenleben mit traumatisierten Partnern, Vätern und Söhnen auch für Frauen und Kinder bedeuten wird, kann man mit Blick auf vergangene Konflikte nur erahnen.
Doch wirft der Krieg seine Schatten auch über das Schlachtfeld hinaus:
In Deutschland wird Scholz scheinbares Zögern bei den Waffenlieferungen mit fehlender Entschlossenheit und zu gering ausgeprägter Männlichkeit erklärt.
Mit einem Diskurs, der Kampfbereitschaft und das Ausüben von militärischer Gewalt (und sei es auch zum Zwecke der „legitimen Verteidigung eines Staates“) zunehmend normalisiert, geht auch einher, dass Verweigerung der Einzelnen, in den Krieg zu ziehen, delegitimiert wird. Das bedeutet eine Gefahr für all diejenigen, die sich nicht einfügen wollen, die „den Schwanz einziehen“, die nicht mitmachen und sich so gut es geht verweigern – die also nicht alles, d.h. ihr Leben geben wollen für staatliche Interessen, die eigene Nation oder das westliche Freiheitsversprechen – auch im Angesicht eines russischen Angriffs.
Eine Kritik des Krieges bedeutet auch Verständnis und Solidarität für diejenigen, die sich verweigern. Das ist auch eine Kritik des Patriarchats – gegen die gesellschaftliche Regression.